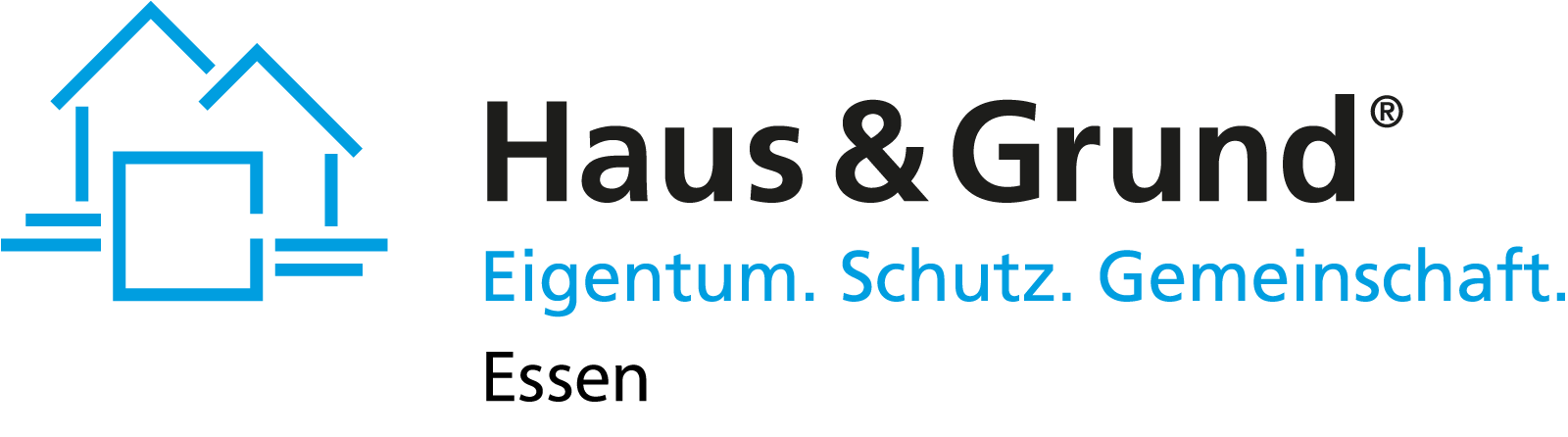
Kameraüberwachung
Stalke deinen Kater – aber bitte nicht deinen Nachbarn
Rund 1,3 Millionen Überwachungskameras sind in Deutschland im Einsatz – an Verkehrsknotenpunkten, im öffentlichen Raum und zunehmend auch in Privathaushalten. Etwa 10 Prozent der Haushalte nutzen intelligente Kameras, sei es zur Einbruchsprävention, zur Parkplatzüberwachung oder aus Neugier, was der eigene Kater tagsüber so treibt. Doch sobald Nachbarn, Besucher oder Mitbewohner ins Bild kommen, ist Vorsicht geboten.
Der Einsatz privater Videoüberwachung unterliegt strengen gesetzlichen Erfordernissen. Maßgeblich ist Artikel 6 Absatz 1 lit. f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): Die Maßnahme muss auf einem berechtigten Interesse beruhen, erforderlich sein und die Interessen oder Grundfreiheiten der betroffenen Person dürfen nicht überwiegen. Darüber hinaus gelten die Grundsätze der Transparenz, der Zweckbindung und der Datenminimierung.
Überwachung des eigenen Grundstücks
Die Überwachung auf dem eigenen Grundstück ist grundsätzlich zulässig – allerdings nur innerhalb der eigenen Grundstücksgrenzen. Öffentliche Wege, Nachbargrundstücke oder Gemeinschaftsflächen dürfen nicht erfasst werden. Zudem müssen Personen, die das Grundstück betreten – etwa Besucher, Paketboten oder Handwerker – über die Überwachung informiert werden. Besondere Anforderungen gelten, wenn nicht nur der private Wohnbereich oder das eigene Grundstück, sondern auch gemeinschaftlich genutzte Bereiche betroffen sind – etwa bei Mietverhältnissen oder innerhalb einer Gemeinschaft der Wohnungseigentümer (GdWE). In diesen Fällen ist eine Videoüberwachung grundsätzlich nur mit Einwilligung der übrigen Betroffenen zulässig. Maßgeblich bleibt stets die Abwägung im Einzelfall nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Aktuelle Entscheidung zur Videoüberwachung in einer GdWE
Wie eine solche Abwägung im Ergebnis aussehen kann, zeigt ein aktuelles Urteil des Landgerichts Dortmund. In einer GdWE führte der Aufzug direkt in die Wohnung eines Eigentümers, der aufgrund seiner früheren Tätigkeit als Oberstaatsanwalt als besonders gefährdet galt. Um sich vor unbefugtem Zutritt zu schützen, installierte er eine nicht ständig aktive Kamera im Aufzug. Das Gericht erklärte die Maßnahme für zulässig: Es habe ein konkretes Sicherheitsinteresse bestanden, mildere Mittel hätten nicht zur Verfügung gestanden und die Überwachung sei auf das erforderliche Maß beschränkt gewesen. Obwohl es sich bei dem Aufzug um Gemeinschaftseigentum handelt, überwog in diesem Einzelfall das Schutzinteresse des betroffenen Eigentümers. Gleichzeitig stellte das Gericht aber auch klar: Ohne eine vergleichbare Gefahrenlage – etwa bei einem gewöhnlichen Sicherheitsbedürfnis – hätte die Abwägung auch zu einem anderen Ergebnis führen können.
Das zeigen zahlreiche andere Gerichtsentscheidungen. So hat das Landgericht Darmstadt bereits eine Kameraattrappe als Eingriff in das Persönlichkeitsrecht gewertet – das Schutzinteresse der betroffenen Mieterin überwiege. Weiter stellte der Bundesgerichtshof (BGH) in einem anderen Fall fest, dass die heimliche Videoüberwachung eines Hauseingangs durch eine Vermieterin unverhältnismäßig sei, da mildere Mittel zur Verfügung gestanden hätten.
Was Eigentümer beachten sollten
Innerhalb der eigenen Wohnung ist eine Videoüberwachung in der Regel unproblematisch – solange keine anderen Personen betroffen sind. Was also beispielsweise das Haustier innerhalb der eigenen vier Wände so treibt, darf nach Belieben verfolgt werden. Sobald jedoch gemeinschaftlich genutzte Bereiche wie Flure, Hauseingänge oder ein gemeinsam genutzter Aufzug von der Kamera erfasst werden, sind gesetzliche Vorgaben zu beachten. Die Zustimmung der anderen Eigentümer oder Mieter ist dann zwingend erforderlich. Auch Dritte – etwa Besucher oder Lieferanten – müssen eindeutig über die Überwachung informiert werden. Nicht selten gibt es aber auch gemeinsame Interessen, wie zum Beispiel die Sicherung von Zugängen oder Fahrradstellflächen. Wer frühzeitig das Gespräch mit den Anwohnern sucht, kann nicht nur rechtliche Klarheit schaffen, sondern gegebenenfalls auch praktikable Lösungen finden – etwa bei der Gestaltung oder der Verteilung der Kosten.
Luisa Peitz
Referentin Recht

